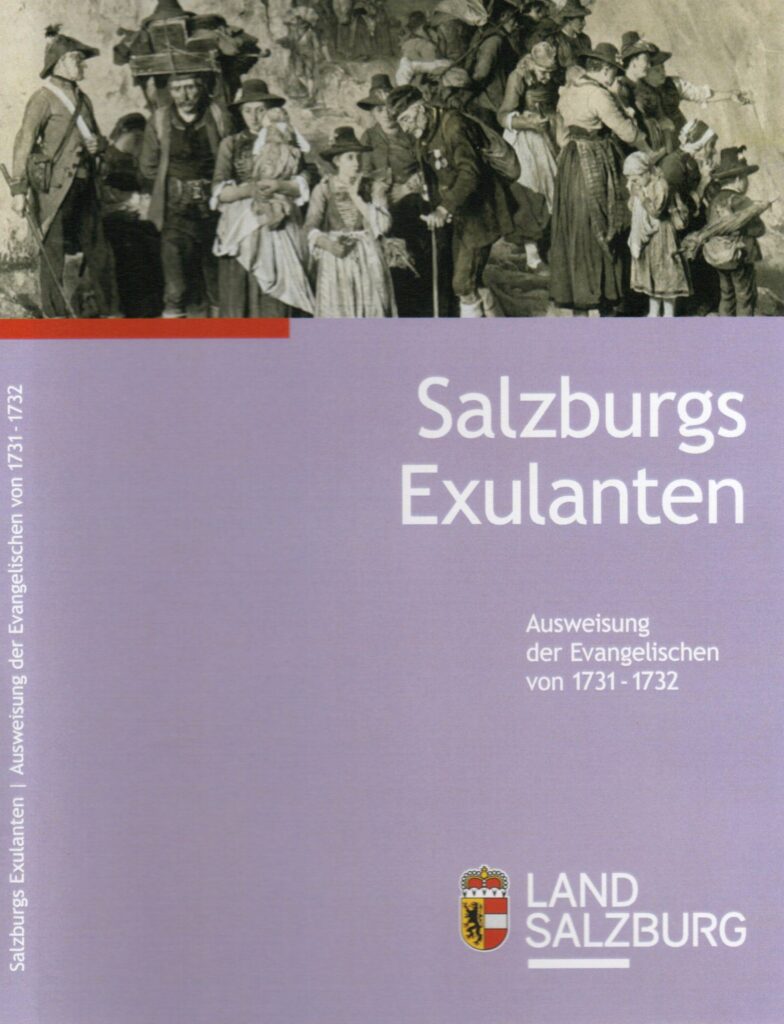Ich, im Namen des gesamten Teams des Diakoniezentrums „Haus Salzburg“, möchte Ihnen unseren aufrichtigen Dank aussprechen und kurz berichten, wie dieses Jahr verlaufen ist.
Das vergangene Jahr war erneut geprägt von vielen Sorgen und Unsicherheiten. Es ist traurig zu sehen, dass sich die Welt in vielem zum Schlechteren verändert – Völker entfremden sich, und frühere Werte verlieren an Bedeutung.
Doch wir wissen, dass wir die Hoffnung nicht verlieren dürfen. Das Leben geht weiter und stellt seine eigenen Anforderungen. Deshalb leben und arbeiten wir, erziehen Kinder und helfen älteren und hilfsbedürftigen Menschen.
Das Jahr war insgesamt ein aktives und arbeitsreiches Jahr. Unsere Programme konnten fortgeführt werden.
Die diakonische Pflegedienstarbeit bleibt ein zentraler Bestandteil unserer Tätigkeit. Besonders gefragt sind weiterhin die ambulante Pflege, die wöchentlichen Mittagessen in der Diakonie sowie die anschließenden gemeinsamen Freizeitstunden, die vom Gemeindepfarrer gestaltet werden.
Bereits Anfang November erwarten wir einen neuen Pastor aus Aserbaidschan, der künftig dauerhaft in Gussew seinen Dienst übernehmen wird. Seine Ehefrau, die über Pflegeerfahrung verfügt, hat den Wunsch geäußert, unsere Arbeit in der Betreuung älterer Menschen zu unterstützen – worüber wir uns sehr freuen. Gemeinsam können wir unsere Erfahrungen bündeln und unsere Arbeit weiter verbessern.
Zu Beginn des Jahres wurde eine neue Satzung ausgearbeitet und registriert.
Die wenigen Anmerkungen, die im Zuge der Prüfung durch das Justizministerium gemacht wurden, konnten erfolgreich behoben werden.
Ebenfalls ist es uns gelungen, den Katasterwert des Diakoniegebäudes erfolgreich anzufechten und auf ein Drittel zu reduzieren – damit konnten die laufenden Unterhaltskosten deutlich gesenkt werden.
Alle traditionellen Veranstaltungen wurden durchgeführt: Weihnachten, Ostern und Erntedankfest.
Als Nächstes stehen der Reformationstag und die Vorbereitungen auf Weihnachten bevor. Wie jedes Jahr bereiten wir Geschenke für unsere Pflegebedürftigen sowie für ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie vor.
In diesem Jahr planen wir außerdem ein gemeinsames Weihnachtsfest für Kinder aus allen Gemeinden des östlichen Bezirks. Die Feier soll in den Räumen der Diakonie stattfinden, mit traditionellen Leckereien und Geschenken. Damit möchten wir die ländlichen und benachbarten Gemeinden unterstützen und den Kindern eine schöne und unvergessliche Feier ermöglichen.
Die Geschenke für jedes Kind sind bereits bestellt. Ein ähnliches Kinderfest ist auch für Ostern 2026 in unserer Diakonie geplant.
Ein Reiseprojekt für Erwachsene, das wir erstmals in den Neujahrsferien 2024 durchgeführt haben, wird ebenfalls fortgesetzt – diesmal mit einem noch umfangreicheren Programm.
Nach wie vor besuchen uns mutige Freunde und Unterstützer aus Berlin, Penkun, Hamburg, Dresden und natürlich Bielefeld – einzeln oder in kleinen Gruppen. Ihre Besuche sind für uns immer eine große Freude und Ermutigung.
Neben der laufenden Arbeit stehen auch wichtige technische Aufgaben an:
Derzeit wird die vollständige Erneuerung der elektrischen Leitungen vom Hauptverteiler zu den Gebäuden der Diakonie, der Kirche und des Gemeindebüros abgeschlossen.
Als nächster Schritt folgt die Erneuerung der Elektroinstallationen innerhalb des Diakoniegebäudes.
Erst danach – voraussichtlich im Januar 2026 – soll die Installation der neuen Gasheizung in der Diakonie und der Kirche beginnen. Dann werden unsere Räume endlich warm und behaglich sein.
Selbstverständlich halten wir unser Gebäude in funktionsfähigem Zustand und führen kleinere Reparaturen regelmäßig durch. Doch seit seiner Errichtung wurde noch keine grundlegende Renovierung vorgenommen – sie ist dringend nötig.
Renovierte Gästezimmer würden uns ermöglichen, Pilgerreisen in unsere schöne östliche Region zu organisieren, ebenso Seminare und Schulungen durchzuführen.
Wir wissen, dass die Zeit nicht einfach ist. Aber wir blicken mit Hoffnung in die Zukunft.
Und wir möchten Ihnen unseren tief empfundenen Dank für alle bisher geleistete Unterstützung aussprechen!
Besonderer Dank
Von Herzen danken wir Elena Sening für ihre langjährige und engagierte Zusammenarbeit mit uns.
Für ihre stete Bereitschaft, in allen Situationen zu helfen, für ihre wertvollen und rechtzeitigen Hinweise, für ihren Optimismus, der uns gerade in schwierigen Momenten neuen Mut gab.
Wir wünschen ihr in ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und Gesundheit.
Mit Wärme und Dankbarkeit erinnern wir uns auch an Jürgen Schröter – an seine Besonnenheit und Weisheit – und an Vera Fartmann, der Gott das Himmelreich schenke, für ihren großen Beitrag zu allem, was heute in der Diakonie funktioniert und weiterbestehen wird.
Vielen, vielen Dank an Sie alle! Mit herzlichen Grüßen,
Ljudmila Ponomarenko
Leiterin des Diakoniezentrums „Haus Salzburg“
Gussew, Kaliningrader Gebiet